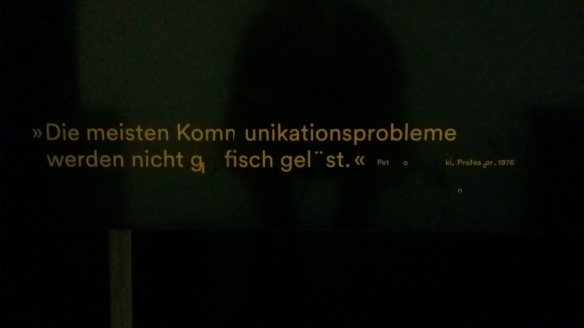Schlagwort-Archive: Kommunikation
Auterrorisierung
Martin Sonneborn schickt eine Interview-Anfrage an die Deutsche Bank. Er möchte über Macht, Finanzkrise, Hedgefonds, Millionengehälter der Bänker sprechen. Die Bank schickt ihm gleich das ganze Interview mit allen Antworten. Allerdings auf ganz andere Fragen.
Genialerweise fragt Sonneborn nun nicht investigativ nach, sondern geht hin und und realisiert das vorgeschriebene Interview Wort für Wort mit dem Kommunikationsmitarbeiter der Bank. Sagt vor, wenn der den Text nicht wörtlich bringt, spricht mit, wenn er ihn bringt. Zum Brüllen komisch. Aber nicht nur.
Man könnte sagen, ein Unternehmenskommunikator, der sich selbst interviewt, nimmt das „kommun“, das Gemeinsame, aus der Kommunikation. Allerdings kommuniziert er ja doch, wenn auch auf einer impliziten Ebene: Spiele mit bei meiner Simulation, sonst bekommst du gar kein Interview mit meinem begehrten Unternehmen.
Unter dem Titel „Wir alle spielen Theater“ hat Erving Goffman beschrieben, wie Menschen fortwährend versuchen, den Eindruck, den sie auf andere machen, in ihrem Sinne zu kontrollieren. Die Sozialpsychologie hat das in einem ganzen Forschungsgebiet „Impression Management“ belegt. Dass Unternehmen ihr Bild in der Öffentlichkeit zielgerichtet steuern wollen, ist selbstverständlich und professionell. Dass dabei Grenzüberschreitungen nicht nur arrogant, sondern dumm weil kontraproduktiv sind, zeigt die vorgeschriebene Interview-Simulation der DB.
So absurd das Ergebnis ist, es steht doch auch für einen allgemeinen Trend. Journalisten leiden zunehmend unter einem Autorisierungswahn. Nicht nur Unternehmen, auch Politiker, Agenten der A-, B- und C-Promis, selbst Privatpersonen scheinen regelmäßig sich am liebsten selbst interviewen zu wollen. Die wenig souveräne Inszenierung beginnt beim Diktat der zugelassenen Fragen, setzt sich fort mit einem Aufpasser bei der mündlichen Darbietung, um dann post festum zuverlässig in einer Zurechtschreibung des tatsächlich Gesagten zu enden. Die Journalisten mühen sich nach Kräften, dem zu widerstehen, doch der Druck ist da.
Das bisschen was ich lese, schreibe ich mir selbst.
Soll Tucholsky geschrieben haben. Überprüfen kann ich das nicht. Ich lese ja nur Selbstgeschriebenes.
Gurkensalat mit Reis
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat!
Am 26. Oktober 1861 führte Philipp Reis das Ur-Telefonat. Zumindest demonstrierte er an diesem Tag in Frankfurt die Funktionsfähigkeit seines Telephon-Prototypen.
Dabei übertrug die Apparatur in den Saal, was sein Schwager im Garten aus einem Buch vorlas. Reis wiederholte das ankommende Gekrächze. Ein Skeptiker argwöhnte, Reis habe den Text auswendig gelernt, und sprach selbst einige möglichst ungewöhnliche Sätze in den Apparat. Eben ”Das Pferd frisst keinen Gurkensalat”. Aber auch “Die Sonne ist von Kupfer”.
”Das Pferd frisst keinen Gurkensalat” war also nicht unbedingt der erste telefonierte Satz, wie häufig behauptet, hat sich aber bis heute besonders eingeprägt.
Reis verstand beide Sätze nicht ganz, aber das Publikum war überzeugt.
Und auch heute noch ruft man sich trotz schlechter Verbindung Sätze zu, auf deren Inhalt es gar nicht ankommt.
Thread lass nach
„Hallo:
ich habe den threat mit großem interesse gelesen..“
Aus einem Konsumentenforum. Der Ton war zuvor tatsächlich schon bedrohlich angeschwollen.
Wissenschaftliche Arbeit dazu:
Viele europäische Sprachen vom „digitalen Aussterben“ bedroht
Zum heutigen „Tag der Europäischen Sprachen“ warnen führende Sprachtechnologie-Wissenschaftler vor einem einem „digitalen Aussterben“ zahlreicher europäischer Sprachen.
Sie untersuchten den „digitalen Rückhalt“ von 30 der insgesamt etwa 80 europäischen Sprachen. 21 Sprachen wurde ein „schwacher oder nicht-existenter“ Rückhalt attestiert.
Das heißt, sie werden bei Rechtschreibprogrammen, automatischen Übersetzungen, Spracherkennung und Spracherzeugung (Navigationssysteme, Smartphones) nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt.
Quasselstoppe
 „Betrachten wir nun die menschliche Stimme als Waffe. Bis zu welchem Grad kann man mit der bloßen Stimme Effekte kopieren, wie sie mit einem Tonbandgerät erzeugt werden können? Lernen mit geschlossenem Mund zu sprechen, sodass die Worte praktisch isoliert im Raum stehen, ist ziemlich einfach“
„Betrachten wir nun die menschliche Stimme als Waffe. Bis zu welchem Grad kann man mit der bloßen Stimme Effekte kopieren, wie sie mit einem Tonbandgerät erzeugt werden können? Lernen mit geschlossenem Mund zu sprechen, sodass die Worte praktisch isoliert im Raum stehen, ist ziemlich einfach“
William Burroughs, Die elektronische Revolution. 1971/1972.
Dauerquassler nerven bekanntlich, nicht nur wenn sie laut sind. Häufig verbinden sie mit ihrem unterbrechungsfreien Gerede die Vorstellung, ihre „Gesprächspartner“ zu beeinflussen, indem sie ihnen ihre Sicht der Dinge aufdrängen.
Aus kommunikationspsychologischer Sicht ist dies natürlich dumm. Denn wer so kommuniziert, hört nur, was er schon weiß, aber nicht, was der andere weiß oder will. Ein klarer Nachteil, weil man generell nichts dazulernt und konkret nichts über den anderen erfährt und ihn so erst recht nicht beeinflussen kann.
Hinzu kommt die „Reaktanz“ beim Partner, der den unfairen Kommunikanten ablehnen wird.
Vor einigen Jahren haben wir an der Universität Heidelberg ein Experiment zum Thema „Überzeugen“ durchgeführt. Unter anderem zeigte sich, dass viel redende Probanden sehr überzeugt sein konnten, ihr Gegenüber von ihrem Standpunkt überzeugt zu haben. „Dem Fräulein habe ich jetzt mal die Augen geöffnet“. Zu dumm, dass wir auch „das Fräulein“ befragten: „Der Blödmann hat nur Stuss geredet, ich bin kaum zu Wort gekommen. Irgendwann war es mir zu blöd und ich habe es ganz gelassen.“ (Aussagen sinngemäß wiedergegeben)
Musik-Einblendung: Mose Allison „Your mind is on vacation and your mouth is working overtime“.
Sprachlicher Dauerbeschuss geht also nach hinten los.
Japanische Forscher verschärfen diesen Effekt nun mit einem sprachlichem „Selbstschussgerät“. Ihr SpeechJammer ist ein handliches Gerät, das per Mikrofon und Lautsprecher für Stille sorgt. Diese Wortkanone gibt dem Quassler die eigenen Worte mit kurzer Verzögerung zurück. Das Echo soll so irritierend sein, dass Weitersprechen nahezu unmöglich wird.
Dass der Effekt auch unplugged funktioniert, zeigen die „Bösen Mädchen“ bei RTL.
Nach radikaler ist die Lösung, die Philip Garner in den Achtzigern vorschlug: Der Talkman (Bild oben), der das Geschwätz ohne jede Umweltbelastung im Schwätzer selbst kurzschließt. Womit wir wieder bei dem Burroughs-Zitat von oben wären.
Die schriftliche Variante des Talkman:
„Das bisschen, das ich lese, schreibe ich mir selbst“.
Kiezdeutsch
Lesetipp zum heutigen „Tag der Muttersprache“:
„Kiezdeutsch“ von Heike Wiese
Tweets aus dem Siebzehnten Jahrhundert
Der Mann ist tot. Seit über dreihundert Jahren. Doch er twittert. Allein heute 4 Tweets. Fast 25.000 Followers.
Samuel Pepys (Bild) (1633-1703), ein hoher Funktionär im Londoner Flottenamt, ein überraschend moderner Urban Professional, ein großer und aktiver Liebhaber der Künste, der Wissenschaften, des Essens, der Frauen. Vor allem aber der Autor der wunderbaren Geheimen Tagebücher. Er schrieb sie von 1660 bis 1669 jeden Tag. Im Geheimen. In einer Kurzschrift, die kaum jemand lesen konnte.
Dies und sein freier Geist ermöglichten eine schonungslose Betrachtung seiner Zeit, seiner Zeitgenossen und seiner selbst. Und das im Zentrum des Geschehens einer aufregenden und gefährlichen Epoche (Kriege, Pest, Große Feuer, Religionsverfolgung, Ausschweifungen, wissenschaftliche Umbrüche). Wer sich nicht mit den vielen kümmerlichen Kompilationen zufriedengibt, sondern in die Gesamtausgaben hineinschaut, wird nicht nur durch die Fülle authentischer Details und Geschichten belohnt sondern auch durch den spektakulären Stil. Der verbindet auf selbstverständliche Weise etwa die große Politik mit intimsten Alltagsdetails.
Schon im ersten Eintrag heißt es übergangslos:
„Meine Frau… machte mir Hoffnung auf ein Kind, aber am letzten Tag des Jahres hatte sie wieder ihre Tage. Die Lage im Staat war wie folgt…“
Und da jeder Eintrag äußerst lesenswert ist, stellt der unermüdliche Phil Gyford seit 2003 Tag für Tag die Pepys-Einträge datumsgleich ins Web. Am 1. Januar 2003 also den ersten Eintrag vom 1. Januar 1660 und so fort bis heute. Das heißt, genau bis zum 31. Mai 2012 (1669). Dann wird Pepys seinen letzten Eintrag mit großem Bedauern (wegen seiner – unbegründeten – Furcht zu erblinden) beenden: „…almost as much as to see myself go into my grave…“
Das wird er dann wohl auch twittern: @samuelpepys. Natürlich wie bisher schon mit Hilfe von Phil.
Ein Tweet vom heutigen 20.1. thematisiert einmal mehr die – berechtigte – Eifersucht seiner Frau:
„My wife letting fall some words of her observing my eyes to be mightily employed in the playhouse, meaning upon women, which did vex me.“
Buch-Tipps:
Die vollständige englische Gesamtausgabe. Ein editorisches Meisterwerk auch unabhängig vom Thema.
Die daran orientierte deutsche Gesamtausgabe. Eine bewundernswerte verlegerische Leistung.
Die hervorragende Pepys-Biographie von Claire Tomalin.
Schamlos Seamless
Neulich in der Park Avenue:
An der Fußgängerampel steht ein junger Typ und telefoniert lautstark vor sich hin.
„Yes, … yes, no, … I am, I am at…“ Übergangslos brüllt er einem distinguierten älteren Herrn ins zentimeterferne Gesicht „Where are we?!
Stoische Antwort: „52nd Street Park Avenue“
„Where?!“
Weiterhin stoisch: „Park Avenue. P-A-R-K Avenue“
„Park Avenue, 52nd Street!“, brüllt der Junge ins Telefon und läuft ohne jeden weiteren Umstand los.
Wie gerufen
Anfang der Siebziger vor einem Mehrfamilienhaus mitten in der Kurpfalz.
Ein Junge ruft aus dem Fenster seinen kleinen Bruder ins Haus: „Alla kumm roi!“
Der versteht das und folgt doch erst nach weiteren Aufforderungen.
Wer das nicht verstehen sollte – es bedeutet so viel wie „Los jetzt, komm herein!“
„Alla“ ist dabei die kurpfälzische Version des französischen „Allez“, die dem Kurpfälzer so selbstverständlich und regelmäßig aus der Kehle kommt wie die Atemluft. Wer etwa zum Aufbruch aufgefordert wird, hört ein „Alla hopp!“, äußert zum Einverständnis ein „Alla gut“ und sagt zum Abschied „Alla dann“.
Dem kleinen norddeutschen Zuwanderer, der damals Ohrenzeuge des „Alla kumm roi!“ wurde, war dies alles fremd. Er ging zu seiner norddeutschen Mama und berichtete, der Nachbarsjunge hieße Allah. Doch, der Bruder hätte ihn mehrfach so gerufen.
Vierzig Jahre später ist die Mehrheit in dem Haus islamischen Glaubens. So hat der kleine Norddeutsche in gewisser Weise doch noch Recht bekommen. Allah jedenfalls scheint den Ruf verstanden zu haben. Allerdings scheint er eine noch viel längere Reaktionszeit gehabt zu haben als der kleine Bruder.
Doch vor dem Herrn sind bekanntlich tausend Jahre wie ein Tag. Und wenn man die fünfzehn Minuten, die der kleine Bruder vielleicht brauchte, dem Ruf ins Haus zu folgen, in fünfzehn Minuten Allah-Zeit umrechnet, kommt man auf etwa zehn Menschenjahre. Und siehe, das ergibt tatsächlich auch die Zeitspanne, nach der die ersten Muslime in das Haus zogen.
Und deren Kindeskinder halten die eingeborenen „Alla!“-Rufer heute vielleicht für kleine Muezzins.